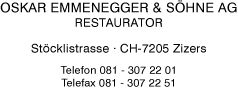|
|

Probleme der Stuckrestaurierung
Stuck-Technik, Anwendungsbereiche, Möglichkeiten
Autor: Prof. Oskar Emmenegger
Wenn von Stuck die Rede ist, so
denkt man zuerst an Arbeiten des 16./17. und 18.
Jahrhunderts und an die berühmten Stukkateure dieser
Zeit wie Carlone, Guliano, Zucchalli, Feuchtmayer oder
die Wessobrunner und so weiter.
Doch Dekorationen aus Stuck sind
nicht eine Tradition der Neuzeit, also des 16., 17., 18.
und 19. Jahrhunderts. Stuck gibt es bereits seit dem
Altertum. Der dazu verwendete Werkstoff war nicht nur
Gips oder ein Gemisch aus Gips, Kalk und Sand, sondern
es wurden auch Mörtel aus Kalk und Sand zum Stuckieren
verarbeitet. In römischer Zeit stand zum Beispiel der
Begriff Stuck allgemein für das, was wir heute als
Verputz bezeichnen, mit dem man unter anderem auch
plastische Dekorationen geführt hat.
Im Altertum und während der Antike
fand im Nahen Osten und Nordafrika vorwiegend Gips
Verwendung. Im Abendland wurde für Stuckarbeiten
Kalkmörtel bevorzugt. Im Antikenmuseum von Ankara ist
Gipsstuck aus einem Tempel von Çatal Hüyük ausgestellt,
der um 6500 vor Christus geschaffen wurde. Im
Nationalmuseum Kairo sind zwei Blöcke ausgestellt, aus
der Zeit um 2400 vor Christus, deren Figuren mit
eingefärbtem Gipsputz in Pastigliatechnik ausgeführt
sind. Für den Meremptahtempel in Luxor hat man
reliefierte Steinblöcke wieder verwendet, die
Götterdarstellungen aus der Zeit Amenophis III, der 18.
Dynastie zeigen. Diese wurden teilweise von Echnaton und
Tutanchamun getilgt und durch neue Götter ersetzt
wurden. Hier zu wurden die Neunennungen, allerding nicht
mit Gips sondern mit Kalksteinmehl und Nilschlamm
aufmodeliert. Der heute Qasr el Bint Firaun genannte Bau
aus der Zeitwende in Pertra, Jordanien, zeigte
ursprünglich keine kahlen Steinwände. Die Nabatäer
bekleideten die Wände mit feinen Architekturgliederungen
aus Gipsstuck.
Während die Ägypter in allen
dynastischen Zeiten fast ausschliesslich Gips als
Stuckmaterial benutzten, entwickelten die minoer auf
Kreta, eine ganz andere Richtung. Sie verarbeiteten
bereits im 16. Jahrhundert vor Christus Kalkmörtel zu
Reliefs und als Intonaco für Wandmalereien in
Freskotechnik. Der Stand der Technik im Umgang mit Kalk
als Bindemittel war bereits so fortgeschritten, dass die
Anfänge weit zurück, wahrscheinlich im Einflussgebiet
Mesopotamiens, zu suchen sind. Diese Technik wurde von
den Mykenern, wie dies ausgestellte Objekte im
Nationalmuseum in Athen belegen, und später auch von den
Hellenen übernommen und weiter entwickelt.
Die Erben dieser Technik waren die
Römer. Sie haben diese Kunst über den gesamten
Mittelmeerraum und tief in den Norden des Abendlandes
vermittelt. Gearbeitet wurde in dieser Art und Weise bis
zum Untergang des römischen Reiches. Nur im oströmischen
Reich und dem nachfolgenden Byzanz und in dessen
Einflussgebieten wird der Kalkmörtel für Stuck auch
weiterhin verarbeitet. Dies schon deshalb, weil dort die
Kunst der Freskomalerei weiter gepflegt wird. Wiederum
dank den Byzantinern gewann der Kalkstuck in
Mitteleuropa an Boden, wenn auch spärlich als Bestand
von Wandmalereien. Vorerst für aufmodellierte Nimben,
wie dies die Beispiele in Brescia, San Salvatore, 8.
Jahrhundert, und St. Angelo in Formis, 11. Jahrhundert,
sowie Werke von Giotto Duccio und so weiter im 13./14.
Jahrhundert belegen. Später folgen Gewandsäume und
andere Appliken wie Aufmodellierungen von Gestühlen,
Betpulten, Sternen, Kronen usw. So die Beispiele in der
Kirche von Eilsum in Deutschland und Taufers, St. Johann
im Südtirol, beide frühes 13. Jahrhundert, und San
Abondio in Como um 1370.
Ab dem 8. Jahrhundert und vermehrt
im 9. Jahrhundert finden wir am Alpensüdfuss in Cividale
bei Udine, im südtirolischen Mals St. Benedikt, in St.
Peter in Gratsch, aber erstaunlicherweise auch in
Corvey, Münster Westfalen, figürlichen und dekorativen
Stuck aus Gips in einer hochentwickelten Technik. Die
fragmentarischen Reliefs im Dom von Hildesheim
schliessen sich hier an. Es liegt fast auf der Hand,
dass wir den Omajjaden, die in Spanien Fuss fassten und
756 Cordoba zu ihrem neuen Hauptsitz machten, die
Verbreitung des Gipsstucks in Europa verdanken.
Anderseits ist der direkte Weg über Byzanz nach Italien
schwer in Abrede zu stellen. Ab dieser Zeit finden wir
vorwiegend in Spanien, Italien, Deutschland, Frankreich
und in der Schweiz Stuckarbeiten aus Gips - eine
Tradition, die sich durchgehend bis in das 16.
Jahrhundert verfolgen lässt.
Eine Ausnahme stellt der Stuck des
8. Jahrhunderts dar, der im Kloster Disentis im Kanton
Graubünden bei Ausgrabungen geborgen wurde. Er ist noch
in antiker Manier mit Kalkmörtel modelliert, durch
Schnitzen geformt und in Freskotechnik bemalt worden. Es
stellt sich hier die Frage: Ist das Beispiel Disentis
eine verbliebene Insel antiker Tradition oder lässt sich
hier fränkischer Einfluss erkennen ? Eine Ähnlichkeit
mit dem Stuck von Poitier ist jedenfalls gegeben.
Bis zum frühen 16. Jahrhundert
finden wir in Europa vereinzelt noch Gips. Doch in
Italien und den Südtälern der Schweiz finden wir
plötzlich wieder für Stuckarbeiten den konstanten
Gebrauch von Mörtel aus Kalk und Sand, ohne jede Zugabe
von Gips. Für die Verbreitung und den erneuten Einsatz
dieses Stuckmaterials in Deutschland, Österreich und
anderen Gebiete sorgten die Comasken, Tessiner und
Bündner Baumeister und Stukkateure.
Dem Mörtelmaterial und der
Mörtelmischung musste die Art der Arbeitstechnik
angepasst werden, was sich wiederum in der Formgebung
der Dekoration ausdrückt. Man kann mit einem Kalkmörtel
nicht genaus gleich gestalten wie mit einem Gips oder
Gipskalkmörtel. Je nach verwendetem Material entstehen
daher andere handwerkliche und fassungstechnische
Voraussetzungen und künstlerische Ausdrucksformen.
Die Putzart bestimmt also die
Formgebung und die Oberflächenbehandlung einer
Stukkierung, es sei denn, der Ausführende vergisst die
Ausführungsregeln und nimmt dadurch baldige Schäden und
ein kurzfristiges Bestehen seines Werkes in Kauf.
Für die Verarbeitung von Gips wurden
im Mittelalter zwei Gipsarten verwendet:
-
Das sogenannte Halbhydrat, das durch Brennen des
natürlich vorkommenden Gipses bei 120 bis 190 Grad
Celsius gewonnen wird. Mit Wasser angesetzt erhärtet es
innerhalb von 20 bis 30 Minuten. Als erhärtete Masse
zeigt sich diese nahezu weiss, ist relativ weich und
lässt sich leicht abschaben. Seine Abbindezeit lässt
sich verzögern durch Zugabe von Kalk, wodurch sich
länger und schöner und länger mit der Masse modellieren
lässt. Weitere Abbindeverzögerer sind etwa die Salze
Alaun und Borax, sowie Glutinleim; sie verleihen dem
Gips zugleich eine grössere Härte und machen ihn
polierfähig. An historischem Stuck konnte bis jetzt,
soweit mir bekannt, der Nachweis von Alaun oder Borax
nicht erbracht werden. Hingegen ist bekannt, und auch
heute noch üblich, dass für die Herstellung von
Stuckmarmor dem Anmachwasser Glutinleim beigefügt wird.
Nur schon ein bis drei Prozent von diesem Leim genügt
bereits, um mit der Gipsmasse zwei bis sechs Stunden
arbeiten zu können. Bei pigmentierten Stuckmassen
kann sich die Abbindezeit verkürzen, bei gleicher
Leimung, je nach Farbe, verkürzen oder verlängern.
Gelber und roter Ocker benötigen zum Beispiel weniger
Leim, für die grüne Umbra und Schwarz muss der
prozentuale Anteil erhöht werden. Zudem erhält der
Stuckmarmor durch den Leim seine typische und
aussergewöhnliche Härte. Für den mittelalterlichen Stuck
scheinen diese Zugaben nicht von Bedeutung gewesen zu
sein.
-
Der Estrichgips entsteht durch Brennen des
Naturgipses bei Temperaturen zwischen 800 bis 1100 Grad
Celsius und mehr. Durch die hohen Temperaturen bildet
sich ein wasserfreies Produkt aus Calciumoxid und
Calciumsulfat. Der mit Wasser angesetzte Estrichgips hat
eine lange Abbindezeit; je nach Eigenschaft des
Ausgangsmateriales zehn bis zwanzig Stunden. Nach
erfolgtem Abbinden schreitet die Erhärtung derart
langsam voran, dass eine Bearbeitung des Stuckes, je
nach der Höhe der Brenntemperatur, noch nach Wochen
möglich ist. Der Estrichgips erreicht eine
aussergewöhnliche Härte und nimmt, abhängig von der Art
des Rohmaterials, eine rötliche, bläuliche oder
gräuliche Färbung an. Die rötliche Farbe des Stuckes,
der in San Pietro al Monte in Civate verwendet worden
ist, entstand nicht durch Einfärben der Stuckmasse,
sondern durch eisenschüssiges Material. Aus dem gleichen
Grund entstand die typische rötliche Farbe, die vielen
Stuckarbeiten des 15. und 16. Jahrhunderts im Kanton
Wallis eigen sind. Es sind reich verzierte
Fenstergewände, Türstürze und Wandbrüstungen; die
Ausführungen befinden sich alle im Freien, womit belegt
ist, dass der hochgebrannte Gips auch wetterbeständig
ist.
Dr. Friedrich Berndt untersuchte in
den dreissiger Jahren in acht Kirchen von Sachsen
mittelalterlichen Stuck. Auf Grund der Analysen belegt
er, dass in dieser Region vorwiegend mit hochgebranntem
Gips gearbeitet worden ist. Zudem stellt er fest, dass
das Mittelalter in dieser Region offenbar den
sogenannten Stuckgips für figürlichen Schmuck nicht
benutzte, sondern den etwas höher gebrannten Baugips,
welcher sich besonders für gegossene Grundformen eignet.
Dass der Estrichgips im Mittelalter
bevorzugt wurde überrascht nicht. Die Eigenschaften,
dass er erstens langsam abbindet und daher lange
modellierfähig bleibt, und zweitens dass er erst nach
Wochen erhärtet und somit ein der Bildschnitzerei
ähnliches Arbeiten ermöglicht, sind die idealsten
Voraussetzungen für eine bildhauerisches Vorgehen. Die
vielen von uns untersuchten Objekte zeigen, was
Werkspuren auf der Bildoberfläche belegen, ein
kombiniertes Vorgehen. So war die Auftragstechnik und
Modellierung, wie sie der Stukkateur heute noch pflegt
bereits eine normale praktische Angelegenheit und die
Schnitztechnik entspricht der Tradition des Bildhauers.
Profile wurden hergestellt, indem durch Ziehen mit einer
Schablone eine Grundform geschaffen wurde, aus der dann
abschliessend Blattformen oder Perlstäbe etc.
herausgeschnitten wurden. Gesichert ist die
Feststellung, dass die Oberflächenbearbeitung stets vor
der völligen Erhärtung des Materials abgeschlossen war.
Dies ergibt sich allein schon aus der Tatsache, dass wir
bis jetzt weder an dekorativem noch an figürlichem
Schmuck Werkspuren des Steinmetz gefunden haben. Die
spätgotischen Dienste und Gewölberippen in der Regula
Kirche in Chur hingegen und die Masswerke und
Fenstersprossen im Chor der Kirche in Waltensburg, beide
im Kanton Graubünden gelegen, sind Ausnahmen. Sie
bestehen aus hochgebranntem Gips und zeigen deutliche
Spuren von Steinmetzwerkzeugen.
Die Stuckarbeiten waren nicht selten
reich und farbig gefasst. Regeln oder regionale
Gegebenheiten lassen sich leider nicht mehr eindeutig
erfassen.
Probleme der Stuckrestaurierung
Noch bis vor kurzem wurde die
Restaurierung - vor allem von renaissancen und barocken
Stuckaturen - zu oft mit unzulänglichen Methoden
durchgeführt. Es wurde korrekt nach handwerklicher
Tradition des Stukkateurs gearbeitet. Der Stukkateur
verstand unter Restaurierung, so wie es in der
Ausbildung seit Jahrhunderten gelehrt wurde: was gut ist
bleibt, das andere wird ersetzt oder ergänzt. Seine
Arbeiten waren Ausbauen loser Stuckteile und das
Zurückfixieren mit Gips oder Zurückschrauben, das
Entfernen der Übertünchungen und der Farbfassung mit
Spachteln und Lanzetten. Stuck aus Gips- / Kalkgemisch
(1)
oder Kalkmörtel ist sehr leicht verletzbar und wurde mit
dieser Methode zerkratzt. Die dadurch verlorene Form der
Oberfläche und nicht mehr ins Niveau gebrachte
eingesetzte Teile wurden nachgeschnitten und neue
Aufmodellierungen angepasst. Damit ging oft der
originale künstlerische Formenausdruck einer Stuckatur
verloren. Dieses Vorgehen entsprach auch dem ehemaligen
Bauhüttenprinzip des Steinbildhauers. Unverzeihlich sind
die Verluste an Farbfassungen. Noch in den 70er Jahren
war die Meinung vieler Stukkateure und oft auch der
Architekten: "Stuck ist weiß". Die grossen Verluste an
Stuckpolychromie sind daher nicht nur dem labilen
Stuckmaterial zuzuschreiben, sondern vorallem der
unkritischen Auffassung, über die Farben von
Stuckaturen. Noch existiert der Einwand, Stuckfarbigkeit
sei eine Angelegenheit nördlich der Alpen. Aber wie die
jüngsten Forschungsergebnisse zeigen, gibt es im Misox
eine Reihe von Beispielen des 17. Jahrhunderts mit Wand-
und Deckenstuck sowie Stuckaltären mit erhaltener
originaler Polychromie.
Nachteilig erwies sich oft eine abschätzige Auffassung
gegenüber der Stuckdekoration. Sie wurde nicht mit dem
gleichen Stellenwert wie Architekur, Malerei und
Skulptur behandelt. Dementsprechend nachlässig war der
Umgang mit diesem "sekundären Kunsthandwerk". Die
Erkenntnis, dass eine Architektur mit Stuck, Malerei und
Skulptur ein Gesamtkunstwerk ausmacht, ist relativ jung.
Deshalb wundert es nicht, dass oft auf Kosten der
Arbeitsqualität bei der Stuckrestaurierung gespart
wurde.
Dieses Vorgehen entspricht allerdings nicht ganz der
Berufsauffassung des Restaurators. Sein Grundsatz ist,
wichtige historische Substanz zu erhalten und zu
konservieren, störende Übermalungen eventuell zu
entfernen und Fehlstellen innerhalb einer Farbgebung zu
retuschieren, um neben der historischen Dimension auch
den überlieferten ästhetischen Wert zu sichern. Sicher
ist sein Ziel auch die Freilegungsmethode zu verfeinern
und zu verbessern. Eine solche Verbesserung war, die
Kalkübertünchungen mit aufgestrichenem Heissleim, der
beim Trocknen Oberflächenspannungen erzeugt, zu
entfernen. Dies kann eine hervorragende und rationelle
Arbeitsmethode sein, eine Methode die allerdings nur in
einem von 10 bis 15 Fällen Erfolg verspricht.
Vorgegossene und aufgeklebte Stuckteile können mit
diesem Vorgehen vom Untergrund weggerissen werden.
Werden Fehlstellen innerhalb der zu entfernenden
Übertünchungen übersehen, und der Leim an der Stelle auf
die originale Oberfläche gestrichen, wird diese vom Leim
sicher abgerissen. Zudem gibt es kein Allgemeinrezept
über die zu verwendende Leimkonzentration. Es muss von
Fall zu Fall neu erarbeitet werden, was viel Erfahrung
verlangt. Ferner empfiehlt sich bei weiss gefasstem
Stuck, wenn er mehrfach ebenso übertüncht worden ist,
nicht auf die erste Fassung freizulegen. Auch die zweite
Fassung vermag oft die Qualität des Stucks ausreichend
zur Geltung zu bringen.
Mit einem Pulverstrahlgerät Übertünchungen zu entfernen,
führt von Ungeübten ausgeführt, zu grossen Verlusten an der
Stuckoberfläche. Der Einsatz des Gerätes ist für die
Stuckfreilegung nur selten verantwortbar. Sicher wird
der Restaurator keine grossflächigen Stuckausbesserungen
oder Ergänzungen durchführen, dazu ist nur der in diesem
Kunsthandwerk geübte Stukkateur zuständig. Konkreter
ausgedrückt; er gibt Gemälde-, Wandmalerei-, Stein-,
Papier-, Textil- und Metallrestauratoren und so weiter,
jedoch keine Ausbildung, die sich im Speziellen
eingehend mit der Stuckrestaurierung befasst. Aus einem
Gipser lässt sich nicht einfach ein Stukkateur und aus
einem Stukkateur ein Restaurator machen. Oder der
Restaurator kann nicht zugleich Stukkateur sein.
Anders liegen die Probleme beim
Stuck des Mittelalters. Dem Alter und den oft
figürlichen Motiven dieser Dekorationen wird heute
offensichtlich mehr Respekt entgegengebracht. Denn bei
notwendigen Massnahmen wird die Konservierung nicht mehr
wie früher dem Stukkateur, sondern dem Restaurator
anvertraut.
Viele dieser Objekte sind
Bodenfunde, die oft seit Jahrzehnten in Kisten lagern
und dort unkontrolliert in Kellern aufgestapelt sind.
Nicht selten müssen sie im nachhinein Objekten weichen,
die den Verantwortlichen wichtiger erscheinen. Verluste
und mechanische Schäden sind die Folge, besonders wenn
die Fragmente aus dem leicht verletzbaren Stuckgips
bestehen. Meistens haben sie im Boden enthaltene Salze
aufgenommen und wurden während dem Trocknungsprozess
durch Salzsprengungen geschädigt. Selbst die mit
widerstandsfähigerem, hochgebranntem Gips oder Kalkputz
geschaffenen Dekorationen werden unter solchen
Lagerungsbedingungen schwer geschädigt. Besonders
gefährdet dabei sind die wertvollen Farbfassungen, die
am mittelalterlichen Stuck unterschiedlich reich
vorkommen.
Erfahrungen von in situ
Restaurierungen mittelalterlicher oder älterer
Stuckarbeiten beschränken sich auf Länder und Regionen,
wo solche Objekte erhalten sind. So zum Beispiel in
Deutschland, Frankreich, Italien, der Schweiz und
Spanien. Die restauratorischen Ausführungen zeigen, ab
dem Ende des 19. Jahrhunderts bis zirka 1970, eine
ähnliche Vorgehensweise wie die an jüngerern
Stuckarbeiten. Die durch Entfernen von Übermalungen und
Farbfassungen zerkratzten Stuckoberflächen sind, mit
wenigen Ausnahmen, das übliche Bild. Deshalb lassen sich
an den Stuckreliefs des 11. und 12. Jahrhunderts in der
Klosterkirche von Müstair nur noch Farbreste nachweisen.
Gleiches gilt auch für die Figuren und Ornamente am
Lettner in der Michaelskirche in Hildesheim (frühes 13.
Jahrhundert). In dieser Hinsicht liessen sich noch
einige Objekte auflisten (2). Grosszügig ging
man auch mit dem Anbringen von Ergänzungen um. Nicht
selten wurde Originalsubstanz abgearbeitet um für
Ergänzungen oder Ersatz einen guten Haftverbund zu
schaffen.
Dass die Farbfassungen der
Chorschrankenfiguren der Liebfrauenkirche in Halberstadt
(Deutschland), die der Ciborien in den Kirchen San
Ambrogio, Milano und San Pietro al Monte, Civate noch
grossflächig erhalten sind, grenzt an ein Wunder.
Die jüngeren
Restaurierungsbeispiele an mittelalterlichem Stuck sind
positiv zu werten. Es wurde durchwegs konserviert und
die Ausführung dokumentiert: historisch bedeutende
Farbfassungen wurden freigelegt, baustatische Schäden
behoben und wo nötig morbider Stuck oder wischende
Farben gefestigt. An mittelalterlichem Stuck wurde
selten ergänzt.
Empfehlungen für die Konservierung
Bevor am Stuck gearbeitet wird, hat
der Restaurator etliche Untersuchungen durchzuführen.
Dies gilt grundsätzlich für Arbeiten aller Epochen.
Zu Untersuchen sind folgende Punkte:
- Wie ist der technische Aufbau und welche
Werkstoffe wurden verarbeitet ?
- Gibt es Farbfassungen, welche Farben und
Bindemittel wurden verwendet ?
- Wie ist der Bestand und Zustand des
Stuckes und der Farbfassung ?
- Finden sich Salzschäden, was häufig bei
Bodenfunden der Fall ist ?
- Ist der Stuck übertüncht, übermalt,
überarbeitet, verkratzt, zerrissen oder lose usw. ?
- Gibt es ältere Restaurierungen und wie
sind diese zu beurteilen ?
- Bei in situ erhaltenem Stuck sind
zusätzliche Abklärungen notwendig betreffend Statik,
Klimaverhältnisse oder schädigenden
Umgebungssituationen.
- Wie ist die Nutzung des stukkierten Raumes
oder wird der Stuck (Bodenfunde) museal aufbewahrt und
welche Sicherheiten sind für den Erhalt des Objektes
gewährleistet ?
In der Regel ist die Beihilfe der
Naturwissenschaft unumgänglich. Sind Probenentnahmen für
naturwissenschaftliche Untersuchungen erforderlich,
müssen die Entnahmestellen dokumentiert und beschrieben
werden. Bei komplexen Situationen empfiehlt sich, dass
bei Probenentnahmen der Naturwissenschafter dabei ist.
Auch er muss sich ein Bild von der örtlichen Situation
machen können. Dies umso mehr, weil dadurch unnötige
Probenentnahmen vermieden werden können, denn jede
Entnahme bedeutet auch Verlust an Originalsubstanz. Sind
solche Fragen geklärt, müsste eigentlich das künftige
Konservierungskonzept für das Objekt zu bestimmen sein.
Deutlich sei hier vermerkt, dass Untersuchungen und
Konservierungsarbeiten nur in engster Zusammenarbeit mit
der Denkmalpflege, dem Besitzer und dem Restaurator
ausgeführt werden sollten. Um effiziente Konservierungs-
und Restaurierungsergebnisse nach heutigem
denkmalpflegerischen Massstab zu erreichen, muss künftig
die Zusammenarbeit des Stukkateurs mit dem Restaurator
gefördert werden (3). Zudem muss die Möglichkeit
der Weiterentwicklung der Stuckkonservierung und
Restaurierung im Sinne der Denkmalpflege geschaffen
werden; dies in Bezug auf Objekte in situ, im speziellen
auf die Besonderheiten mittelalterlicher Kunstwerke und
die besonderen Probleme für Bodenfunde.
Zusammenfassung
Seit dem Altertum bis zum 19.
Jahrhundert waren Stuckdekorationen ein beliebtes
Kunsthandwerk. Als Werkstoff diente ein Mörtel aus Gips,
dem Gemisch Gips, Kalk und Sand oder einer
Kalksandmischung. Im Mittelalter wurde neben dem
normalen Stuckgips (Halbhydrat) der hochgebrannte
Estrichgips verarbeitet. Stuckarbeiten der
vorgriechischen Kulturen der Ägäis und der Antike
bestehen wie jene der Renaissance und des Barock südlich
der Alpen vorwiegend aus Kalk und Sand (ohne
Gipszusatz). Diese Materialzusammensetzung wurde
nördlich der Alpen nur von den Stukkateuren aus
Oberitalien, dem Misox und Tessin verwendet. Stuck ist
ein relativ weiches Material und durch unsachgemässe
Behandlung sehr gefährdet. So fielen zahlreiche farbige
Bemalungen der Ansicht zum Opfer, Stuck hätte weiss zu
sein. Um künftig weiteren Schäden vorzubeugen, ist die
Zusammenarbeit von Stukkateur und Restaurator zu
intensivieren und die Weiterentwicklung der
Stuckkonservierung nach heutigen denkmalpflegerischen
Prinzipien zu fördern.
Anmerkung:
- Gemeint ist der bei 120° bis 190° Celsius
gebrannte Stuckgips (Halbhydrat)
- Im Gegensatz zu den in Situobjekten, die
wiederholt aus modischen Gründen farbig verändert worden
sind, finden wir am Stuck von Bodenfunden häufiger
erhaltene Farbfassungen.
- Es gibt in einigen Ländern Europas
Weiterbildungskurse für Stukkateure. Dies vorallem im
Bereich der verschiedenen Stucktechnologien, der
Material- und Stilkunde. Stukkateure, die solche Kurse
besucht haben, sind danach qualifizierte Fachleute. Sie
sollten in der Lage sein, hervorragende Ergänzungen
durchzuführen. Doch wurde das denkmalpflegerische
Prinzip "Erhalten der Originalsubstanz" sie
vernachlässigt. Dies, weil zu oft qualitativ ersetzbar
geworden ist.
Copyright © 1997 Prof. Oskar Emmenegger and Oskar Emmenegger & Söhne AG. All rights reserved.
|