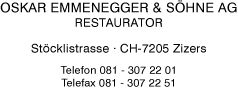Die Übertragung der romanischen Wandmalereien
der
Kapelle St. Jakob in Söles
Autor: Prof. Oskar Emmenegger
Im Auftrag der Denkmalpflege planten und leiteten wir
die Konservierung und Übertragung der bei
archäologischen Grabungen geborgenen Malereien des
frühen 13. Jahrhunderts. Die Ausführung erfolgte in
Zusammenarbeit mit Dr. Giovanna Fusi, Restauratorin für
archäologische Bodenfunde, Günter Niederwanger,
Grabungstechniker, Hubert Mair, Restaurator und
Mitarbeiter und die projektleitenden Restauratoren Oskar
und Rufino Emmenegger.
Probleme der Übertragung
Viele Wandmalereien, die in Museen oder Kirchen
ausgestellt sind, zeigen schwere Schäden, die durch
Ablösen und Übertragen entstanden sind. Vorallem die
Trägersysteme, die noch bis in die Siebzigerjahre
angewendet wurden, bedeuten eine Gefahr. Mit Kalkkasein
oder Dispersion aufgeklebte Gewebe ziehen sich bei
Feuchtigkeitsaufnahme zusammen und dehnen sich bei
Feuchtigkeitsabgabe. Diesen Bewegungen folgt der
originale Verputz als Bildträger einer Abnahme nicht und
wird mit der Zeit abgestossen. Ein weiterer
Schadensfaktor bilden hölzerne Spannrahmen für das
Trägergewebe. Entlang dem Spannrahmen wird der Verputz
vom Gewebe abgestossen. Bei einer Strappo-Abnahme wirkt
sich die Reaktion des aufgeklebten Trägergewebes direkt
auf die Malschicht aus; sie zerreisst und die
entstandenen Farbinseln werden schüsselförmig
deformiert. Dazu kommt, dass die Malerei den
Alterungsprozess der verwendeten Klebstoffe mitmacht,
vorallem organische Bindemittel quellen und schrumpfen
je nach Klimawechsel und trennen sich abrollend vom
Trägergewebe. Diese unaufhaltbaren Schadensprozesse
führen zu grossen Malereiverlusten.
Ein weiteres Problem sind die Festigungs- und
Fixiermittel wie Kasein, Leim, Cellulose, Gummi arabicum,
Wasserglas, Dispersion oder in Lösemittel gelöste
Acrylharze, mit denen sandende Putze und wischende
Malschichten gefestig wurden. Sie verändern die rein
mineralischen Putz- und Malsysteme der Fresko- oder
Kalkmalerei, verdichten die Oberfläche, bilden teilweise
Verkrustungen und lose Farbschollen. Die organischen,
hygroskopischen Bindemittel verursachen
Oberflächenspannungen.
Dadurch sind Schäden wie Salzausblühungen durch
Wasserglas, Schalenbildungen mit nachfolgenden
Putzblasen und losen Farbschollen, abrollende und
splitterig sich abhebende Malschichten vorprogrammiert.
Malereien mit solchen Schäden zu konservieren,
entstanden durch massive und unkritische Anwendung
artfremder Klebstoffe, machen leider einen Grossteil der
Restauratorenarbeit aus. Aufgrund dieser Situation
versuchten wir neue, dem Kalk angepasstere Binde- und
Festigungsmittel zu testen und die entsprechende
Arbeitsmethode zu entwickeln.
Eine Alternative ist der Kieselsäureester, den wir vor
über 30 Jahren getestet und für die Restaurierung von
Wandmalereien in der Denkmalpflege eingeführt haben.
Beim Abbindevorgang des Kieselsäureesters bilden sich
aus Siliciumdioxidgel SiO2-Kristalle, die die Festigung
der geschädigten Putz- und Malschicht bewirken.
Die jüngste Methode, mit deren Entwicklung wir in den
Siebzigerjahren begonnen haben, ist die Festigung
geschädigter oder zu schwach gebundener Kalkputze,
Fresko- und Kalkmalereien durch Kohlendioxidbegasung. Es
ist im Prinzip die Abbindung eines Kalkmörtels, wie sie
in der Natur geschieht. Nur entsteht durch dieses
Verfahren eine beschleunigte Festigung, wie sie auf
natürliche Weise erst nach Jahrhunderten erreicht wird.
Ein Kalkmörtel, bestehend aus Calciumhydroxid Ca (OH)2
und Sand, bindet ab durch die Aufnahme von Kohlendioxid
CO2. Dabei entsteht aus dem Calciumhydroxid
Calciumcarbonat Ca CO3. Die Bindung und die Härte des
Verputzes entsteht durch die Calciumkarbonatkristalle,
die den Sand umhüllen und verbinden. In gleicher Weise
erfolgt die Bindung der Fresko- und Kalkmalerei.
Festigung der Malereifragmente von Söles
Die in Freskotechnik gemalten Fragmente und den neuen
Trägermörtel haben wir durch CO2-Begasung gefestigt.
Dazu benutzten wir flüssiges CO2 aus der Flasche. Diese
Methode wurde bevorzugt auf Grund der vielen
untersuchten negativen Beispiele und der beobachteten
Folgeschäden an Objekten, die mit organischen
Werkstoffen behandelt worden sind. Ferner gibt es
Objekte, wo wir diese Konservierungs- und
Festigungsmethode bereits mit Erfolg angewendet haben
(1).
Um die nur 3 bis 6 mm starken Malereifragmente
anfassen und zu grösseren Einheiten verkleben zu können,
ohne dass sie zerbrachen, musste man die Rückseite mit
Kalkmörtelschichten verstärken. Da die natürliche
Abbindung eines Kalkmörtels mehrere Monate oder gar
Jahre dauern kann, haben wir durch CO2-Begasung
nachgeholfen. Dadurch wurde der Abbindungsprozess des
neuen Trägermörtels auf 8 bis 12 Std. verkürzt. Mit der
Begasung wurden gleich 3 Ziele erreicht:
- Die Umsetzung von Ca (OH)2 des
Trägermörtels zu Calciumcarbonat Ca CO3
wurde verkürzt, so das in nützlicher
Frist weiter gearbeitet werden konnte.
- Das im Originalputz vorhandene Calciumcarbonat ist durch
Rekristallisieren am
Konservierungsprozess mitbeteiligt.
(2)
- Der Haftverbund der beiden
Putzschichten ist gewährleistet durch
die Rekristallisation des Calciumcarbonats im Originalputz und dem
gleichzeitigen Carbonatisieren des
Calciumhydroxids im neuen Mörtel.
Zur Begasung der kleinen Bildeinheiten benutzten wir
eine tiefe aber ungedeckte Plastikwanne, denn die
überschüssige Feuchtigkeit muss entweichen können. Zudem
ist während dem Begasen der Pegel des spezifisch
schweren CO2-Gases zu kontrollieren, so dass man bei
Bedarf neues CO2 in den Bereich des Objektes zufliessen
lassen kann.
Anschliessend wurden die grösseren stabilisierten
Fragmenteinheiten direkt in frischen, noch
modellierbaren Kalkmörtel gebettet und nach dem
Antrocknen durch CO2-Begasung endgültig miteinander
verbunden.
Beim Zusammensetzen der Fragmente auf Sand, stellte man
fest, dass die Bildoberfläche von ungewöhnlich starken -
bis zu 25 cm hohen, Wellenbewegungen geprägt war. Um
diese massiven Höhenunterschiede auszugleichen, waren
Aufmodellierungen mit Kalkmörtel erforderlich, die
ebenfalls begast wurden. Damit das Gewicht der bis zu
4m2 grossen Bildflächen nicht allzu schwer wird, hat man
grosse Holzkohlenstücke in den Setzmörtel eingebettet.
Zusätzlich waren Vorformungen mit bis zu 6 cm starken
Airexplatten notwendig. Den eigentlichen Bildträger
bilden 30 mm starke Aluwabenelemente, die beidseitig mit
Araldit gebundenen Glasfaserlaminat beschichtet sind
(3). Die Beschichtung mit dem Glasfaserlaminat wurden in
unserer Werkstatt angefertigt. Die Verklebung erfolgte
unter Vakuum mit einem Druck von zirka 7'000 kg/m2 sowie
bei einer Temperatur von 40 bis 50 Celsius.
Auf Aralditbeschichtungen und Airexplatten entsteht mit
einem Kalkputz kein Haftverbund. Deshalb haben wir das
Airex und die Laminate zur Bildfläche hin mit dem
Grundierharz Araldit 410 versehen und sofort vor dem
Polymerisieren gesandelt. Auf diese Sandschicht konnte
nun der Kalkmörtel problemlos appliziert werden. Damit
zwischen den Trägerplatten und der Putzschicht keine
Trennung durch Spannungen entstehen kann haben wir, von
der Rückseite her tief in den Trägerteil aus Putz,
Verankerungen mit Inoxstahlstiften als zusätzliche
Sicherheit eingeklebt (Kleber Hilti HIT C-156).
Zusammenfassung
Mit der Entwicklung dieses Festigungsverfahrens begannen
wir bereits in den Siebzigerjahren. Jedoch brauchten wir
viel Zeit um die vorerst an Prüfkörpern erzielten
Erfolge in die Praxis umzusetzen. Der grosse Zeitaufwand
für die Versuche hat sich gelohnt, lassen sich doch
Fresko- und Kalkmalereien mit dem gleichen Abbindesystem
konservieren. Vorallem lässt sich die Verwendung
artfremder Werkstoffe weitgehend einschränken. Dadurch
wird ein grosser Schadensfaktor beseitigt. Die
CO2-Begasung - für die Konservierung von Wandmalereien
neue und noch nicht bekannte Methode, verlangt viel
Erfahrung und ein gut eingespieltes Team. Es sind
während der Ausführung viele Details zu beachten, um
gute Resultate garantieren zu können.
Anmerkungen:
- Einige
Beispiele: - Gotische Dekorationsmalerei
des frühen 16. Jahrhunderts im alten
Gymnasium in Luzern. - Geborgene
Malereifragmente des 12. Jahrhunderts
der St. Michaelskirche in Hildesheim. -
Übertragenes Wandbild des 19.
Jahrhunderts von Moritz Schwind auf der
Wartburg in Eisenach. - Oberkörper einer
monumentalen Christopherusdarstellung
des Waltensburgermeisters um 1340,
Zillis GR.
- Dr. Goretzki: Untersuchungen und
naturwissenschaftliche Begleitung zum
Projekt: Abnahme des Schwind-Freskos,
"Ankunft der heiligen Elisabeth auf der
Wartburg".
- Weimar 1992, MS
Wartburgstiftung.
- Verwendet wurde Araldit HY554,
dem als Verschnitt Kreide beigemischt
wurde.
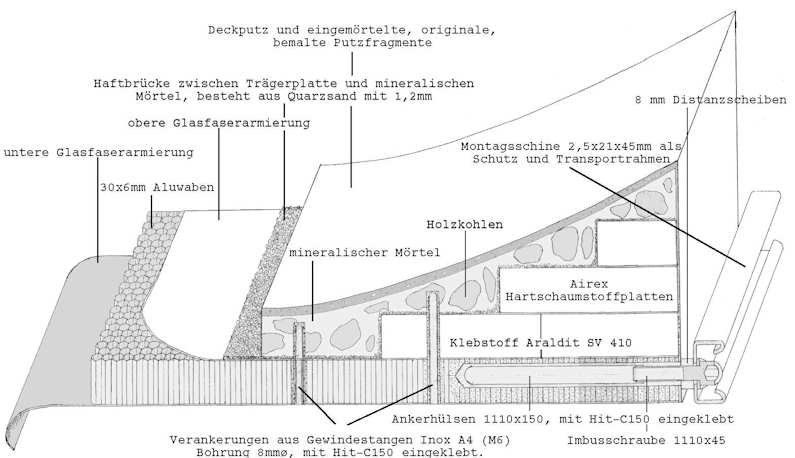
Copyright © 1997 Prof. Oskar Emmenegger and Oskar Emmenegger & Söhne AG. All rights reserved.
|